Wer Eigentümer in einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern (GdWE) ist, weiß, wie wichtig die Arbeit des Verwalters für den Werterhalt und die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Immobilie ist. Als zentrales Organ der Gemeinschaft übernimmt der Verwalter zahlreiche Aufgaben, trifft Entscheidungen mit weitreichenden finanziellen Folgen und vertritt die Eigentümer nach außen.

Dabei kann es vorkommen, dass der Verwalter seine Aufgaben und Pflichten verletzt. Solche Pflichtverletzungen können unter Umständen zu einer Haftung des Verwalters gegenüber der Gemeinschaft, aber auch gegenüber eventuell durch die Pflichtverletzung geschädigten Dritten führen. Andererseits führt aber nicht jede kleine Pflichtverletzung oder jedes kleine Versäumnis zu einer Schadensersatzpflicht des Verwalters.
In diesem Beitrag informiert Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht Michael Kehren darüber, was passiert, wenn Fehler passieren, wann der Verwalter persönlich für Pflichtverletzungen haftet, welche Ansprüche den Wohnungseigentümern zustehen und warum es wichtig ist, sich bei Verdacht auf Pflichtverletzungen frühzeitig anwaltlich beraten zu lassen.
Welche Rolle spielt die Haftung des Verwalters für die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer?
Wer Eigentümer in einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist, weiß, dass der beauftragte Verwalter einer solchen Gemeinschaft eine zentrale Rolle bei der Werterhaltung und Verwaltung der Immobilie spielt, da er kraft Stellung und Beauftragung für die Wohnungseigentümer tätig wird.
Der Verwalter ist dabei praktisch eine Art Geschäftsführer der Wohnungseigentümergemeinschaft, so dass er sich u.a. um Abrechnungen, Instandhaltungen, Baumaßnahmen, Mängelbeseitigungen, Versicherungen, die Durchführung von Eigentümerversammlungen und viele weitere organisatorische und rechtliche Aufgaben kümmert. Als zentraler Ansprechpartner ist er für alle Belange der GdWE zuständig.
Verwalter ist zentrales Organ der GdWE
Der Verwalter handelt anstelle der Wohnungseigentümer als zentrales Organ der Wohnungseigentümergemeinschaft und trifft in dieser Funktion häufig Entscheidungen mit erheblichen tatsächlichen und finanziellen Auswirkungen. Gerade deshalb ist es für Wohnungseigentümer wichtig zu wissen, wann und in welchem Umfang der Verwalter bei Fehlern haftet. Fehler oder Pflichtverletzungen des Verwalters können schnell zu hohen Schäden führen, zum Beispiel durch:
- verspätete oder fehlerhafte Jahresabrechnungen,
- nicht entdeckte Baumängel,
- versäumte Gewährleistungsfristen,
- eigenmächtige oder schlecht verhandelte Vertragsabschlüsse.
Auswirkungen von Fehlern kann beträchtlich sein
Oft bleibt es bei Fehlern nicht nur bei kleinen Unannehmlichkeiten. Die Wohnungseigentümergemeinschaft kann durch Fehler des Verwalters erhebliche finanzielle Einbußen erleiden oder rechtliche Auseinandersetzungen riskieren. Im Extremfall drohen Streitigkeiten mit Handwerkern, Mietausfälle oder langwierige Gerichtsverfahren gegen säumige Eigentümer, weil der Verwalter nicht rechtzeitig oder nicht richtig gehandelt hat.
Dabei haftet der Verwalter nicht automatisch, sobald ein Fehler passiert. Hier ist die Rechtslage differenziert. Nicht jeder Fehler löst eine Haftung aus, aber bei Pflichtverletzungen besteht unter bestimmten Voraussetzungen ein Schadensersatzanspruch der Wohnungseigentümergemeinschaft gegen den Verwalter. Klare vertragliche Vereinbarungen und eine frühzeitige rechtliche Prüfung können hier helfen, dass der Verwalter für seine Fehler und Pflichtverletzungen haftet und die Wohnungseigentümer nicht allein auf dem entstandenen Schaden sitzen bleiben.
Haftung nicht nur Rechtsfrage, sondern mit praktischen Auswirkungen für GdWE
Die Haftung des Verwalters betrifft daher nicht nur eine abstrakte Rechtsfrage im Verhältnis zur Wohnungseigentümergemeinschaft. Die Frage der Verwalterhaftung schützt unmittelbar das Vermögen und die Rechtspositionen der Wohnungseigentümer. Wer sich hier gut informiert, kann finanzielle Schäden vermeiden und seine Immobilie langfristig absichern.
Welche Rolle spielt der Verwalter?
Der Verwalter ist das Verwaltungsorgan und der zentrale Ansprechpartner für die täglichen Belange der Eigentümergemeinschaft und damit in erster Linie der Organisator des täglichen Betriebes einer Immobilie. Aufgrund seiner Organstellung innerhalb der Gemeinschaft und seiner gesetzlichen Aufgaben ist der Verwalter aber auch das rechtliche Bindeglied zwischen der Eigentümergemeinschaft und Dritten nach außen.
Er organisiert die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums, setzt die Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft um und vertritt die Gemeinschaft gerichtlich und außergerichtlich. Dabei kommt ihm eine Doppelfunktion zu: Im Innenverhältnis handelt er treuhänderisch im Interesse aller Wohnungseigentümer, nach außen vertritt er die Gemeinschaft als deren gesetzlicher Vertreter.
Sein Handeln wirkt unmittelbar für und gegen die Gemeinschaft. Daraus ergibt sich eine besondere rechtliche Verantwortung, denn der Verwalter hat die Interessen aller Wohnungseigentümer zu wahren und die Regeln ordnungsgemäßer Verwaltung strikt zu beachten.
Gesetzliche Aufgaben und Pflichten
Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) weist dem beauftragten Verwalter verschiedene gesetzliche Aufgaben und Pflichten zu. Bis zur WEG-Novelle 2020 enthielt § 27 WEG eine Aufzählung von Aufgaben und Pflichten, die der Verwalter zu erfüllen hatte. Nach der WEG-Novelle enthält § 27 WEG nun nur noch eine Aufzählung von Aufgaben, die der Verwalter auch ohne Beschluss und Zustimmung der Wohnungseigentümer durchführen darf oder muss. Nach § 27 WEG kann der Verwalter ohne vorherige Beschlussfassung der Wohnungseigentümer kleinere Maßnahmen von untergeordneter Bedeutung selbständig durchführen oder bei drohenden Nachteilen schnell handeln (Notgeschäftsführungsrecht).
Im Übrigen enthält das WEG hinsichtlich der Aufgaben und Pflichten des Verwalters vor allem solche, die sich aus seiner Organstellung ergeben oder die ihm gesetzlich zwingend zugewiesen sind, wie die Einberufung und Leitung von Eigentümerversammlungen, die Aufstellung von Wirtschaftsplänen, Jahresabrechnungen und Vermögensverzeichnissen sowie die Führung der gemeinschaftlichen Konten. Darüber hinaus muss der Verwalter für die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums sorgen, offene Forderungen konsequent einfordern und über alle Verwaltungsvorgänge transparent informieren.

Eine ausführliche Beschreibung der Aufgaben und Pflichten des Verwalters finden Sie in diesem Artikel.
Verwaltungsvertrag als rechtliche Grundlage
Betrachtet man die gesetzlichen und organschaftlichen Aufgaben und Pflichten des Verwalters, so wird deutlich, dass viele dieser Aufgaben und Pflichten, die der Verwalter tagtäglich ausfüllt und erledigt, nicht explizit im WEG geregelt sind oder erwähnt werden. Da die konkreten Aufgaben und Pflichten des Verwalters auch immer von der Art und Größe der zu verwaltenden Immobilie und den von den Wohnungseigentümern an den Verwalter delegierten Aufgaben abhängen, ist die Grundlage für die Tätigkeit des Verwalters immer der Verwaltervertrag. Dieser stellt rechtlich einen Geschäftsbesorgungsvertrag dar (§ 675 BGB i.V.m. § 611 BGB). Im Verwaltervertrag werden die genauen Aufgaben, Rechte und Pflichten des Verwalters festgelegt.
Typische Regelungen betreffen:
- den konkreten Aufgabenumfang (z.B. technische Verwaltung, kaufmännische Verwaltung, Durchführung von Eigentümerversammlungen),
- die Vergütung des Verwalters,
- die Dauer der Verwaltertätigkeit und die Voraussetzungen für eine ordentliche oder außerordentliche Kündigung,
- mögliche Haftungsbeschränkungen (soweit rechtlich zulässig).
Der Vertrag bildet somit den Rahmen, innerhalb dessen der Verwalter tätig wird. Eine sorgfältige Gestaltung des Verwaltervertrages ist sowohl für den Verwalter als auch für die Eigentümer unerlässlich, um spätere Haftungsfragen oder Kompetenzstreitigkeiten zu vermeiden.
Gesetzliche Grundlagen für die Tätigkeit des Verwalters
Die Tätigkeit des Verwalters wird nicht nur durch den Verwaltervertrag, sondern auch durch gesetzliche Bestimmungen, insbesondere durch das Wohnungseigentumsgesetz (WEG), geregelt:
- Wohnungseigentumsgesetz (WEG):
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB):
- Nach außen vertritt der Verwalter die Gemeinschaft gemäß § 9b Abs. 1 und 2 WEG, handelt also im Namen der Wohnungseigentümergemeinschaft und verpflichtet diese rechtlich gegenüber Dritten.
Verantwortung und Haftungsrisiken
Der Verwalter trägt viel Verantwortung für die Wohnungseigentümergemeinschaft und läuft auch Gefahr, bei Fehlern oder Pflichtverletzungen in Haftung genommen zu werden. Verletzt der Verwalter schuldhaft seine Pflichten, z.B. durch fehlerhafte Abrechnungen, verspätete Instandhaltungen oder unzulässige eigenmächtige Entscheidungen, kann er gegenüber der Eigentümergemeinschaft schadensersatzpflichtig werden.
Dabei genügt bereits einfache Fahrlässigkeit, um eine Haftung auszulösen, sofern keine wirksame Haftungsbeschränkung vereinbart wurde. Besonders kritisch wird es, wenn der Verwalter Gelder der Gemeinschaft nicht ordnungsgemäß verwaltet oder Instandhaltungsmaßnahmen verschleppt. Eine Berufshaftpflichtversicherung ist daher dringend zu empfehlen, auch wenn sie gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.
Wann haftet der Verwalter?
Ob ein Verwalter für Fehler, Versäumnisse oder Pflichtverletzungen haftet und sich schadensersatzpflichtig macht, hängt in erster Linie davon ab, welche Pflicht verletzt bzw. welche Aufgabe fehlerhaft erfüllt oder unterlassen wurde. Es muss sich um eine Aufgabe oder Pflicht handeln, die kraft Gesetzes und/oder aufgrund des Verwaltervertrages zur Tätigkeit des Verwalters gehört.
Pflichtverletzung
Grundsätzlich richtet sich die Haftung des Verwalters nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch, insbesondere nach § 280 Abs. 1 BGB. Er haftet, wenn er eine Pflicht aus dem Verwaltervertrag oder dem Gesetz verletzt, dadurch ein Schaden entsteht und er schuldhaft, also mindestens fahrlässig, gehandelt hat. Eine Haftungsfreistellung ist nur möglich, wenn sie wirksam vertraglich vereinbart wurde, woran hohe rechtliche Anforderungen gestellt werden.
Typische Fehlerquellen für eine Haftung
In der Praxis gibt es viele typische Fehlerquellen, bei denen eine Haftung des Verwalters wegen Pflichtverletzung in Betracht kommt.
Beispiele hierfür sind
- Vorbereitung der Eigentümerversammlung: Eine der wichtigsten Aufgaben des Verwalters ist die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Eigentümerversammlung. Insbesondere bei der Beschlussfassung hat der Verwalter auf korrekte und eindeutige Beschlüsse hinzuwirken. Kommt es dabei zu Formfehlern, können diese zu einer erfolgreichen Beschlussanfechtung führen. In diesen Fällen haftet der Verwalter dann hinsichtlich der Prozesskosten, soweit diese auf einer Pflichtverletzung des Verwalters beruhen.
- Fehlerhafte Abrechnungen: Aufgabe des Verwalters ist die Erstellung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftsplans und einer ordnungsgemäßen Jahresabrechnung. Fehler in diesen Unterlagen können schwerwiegende Folgen haben. Dazu gehören beispielsweise falsche Umlageschlüssel, nicht berücksichtigte Einnahmen oder Ausgaben oder die Belastung unbeteiligter Eigentümer mit Kosten. Rechnet der Verwalter falsch ab, müssen die Eigentümer unter Umständen zu hohe Hausgelder zahlen oder es entstehen Liquiditätsengpässe in der Gemeinschaft. Im schlimmsten Fall sind die Eigentümer gezwungen, Sonderumlagen zu beschließen, um die entstandenen Fehlbeträge auszugleichen.
- Untätigkeit bei Schäden: Ein weiterer häufiger Haftungsgrund ist die Unterlassung notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen. Stellt der Verwalter einen offensichtlichen Schaden fest, z.B. einen Wasserschaden, defekte Fenster oder ein undichtes Dach, ist er verpflichtet, unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Eine solche Pflicht zum unverzüglichen Handeln auch ohne Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft kann sich auch aus § 27 Abs. 1 Nr. 2 WEG ergeben. Zögert der Verwalter oder bleibt er untätig, kann sich der Schaden ausweiten und die Kosten für die Wohnungseigentümergemeinschaft erheblich erhöhen. Beispiel: Nach einem Unwetter treten Risse im Dachstuhl auf. Der Verwalter nimmt den Schaden zur Kenntnis, unterlässt aber sofortige Sicherungsmaßnahmen. Monate später tritt Feuchtigkeit ein und es kommt zu erheblichem Schimmelbefall, der teure Sanierungsarbeiten erforderlich macht.
- Eigenmächtige Entscheidungen: Der Verwalter darf in der Regel keine größeren Verträge ohne vorherige Zustimmung der Eigentümergemeinschaft abschließen. Insbesondere bei längerfristigen Bindungen oder hohen Kosten ist ein Beschluss zwingend erforderlich. Verträge von untergeordneter Bedeutung kann der Verwalter jedoch gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 1 WEG auch ohne Beschluss abschließen. Überschreitet der Verwalter seine Kompetenzen und die Grenze zur untergeordneten Bedeutung, kann er für daraus entstehende Schäden persönlich haften. Beispiel: Der Hausverwalter schließt ohne Beschluss einen fünfjährigen Wartungsvertrag für die Heizungsanlage ab, obwohl die Eigentümergemeinschaft nur eine jährliche Wartung beauftragen wollte. Dadurch entstehen der Gemeinschaft überhöhte Kosten, die sie ohne Zustimmung tragen muss.
- Verletzung der Verkehrssicherungspflicht: Der Verwalter ist verpflichtet, Gefahrenquellen am Gemeinschaftseigentum zu erkennen und zu beseitigen oder geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Unterlässt er dies, haftet die Gemeinschaft gegenüber geschädigten Dritten. Der Verwalter kann dann von der Gemeinschaft in Regress genommen werden. Darüber hinaus kommt auch ein Schadenersatzanspruch Dritter gegen den Verwalter in Betracht. Beispiel: Ein Gehweg auf dem Grundstück der Wohnanlage ist im Winter glatt, weil der Verwalter keinen Winterdienst organisiert hat. Eine Besucherin stürzt und zieht sich schwere Verletzungen zu. Die Eigentümergemeinschaft wird auf Schmerzensgeld verklagt und kann den Verwalter in Regress nehmen.
- Mangelnde Kommunikation: Ein Verwalter muss die Eigentümer rechtzeitig und umfassend über alle wichtigen Vorgänge informieren. Dazu gehören zum Beispiel anstehende Instandsetzungsmaßnahmen, Zahlungsrückstände einzelner Eigentümer oder Rechtsstreitigkeiten. Verschweigt der Verwalter wichtige Informationen, kann dies zu finanziellen oder rechtlichen Nachteilen für die Gemeinschaft führen. Beispiel: Der Hausverwalter erfährt, dass ein Handwerksbetrieb die Arbeiten an der Fassade nicht mängelfrei ausgeführt hat, informiert die Eigentümer aber nicht rechtzeitig. Dadurch verstreicht die Gewährleistungsfrist und die Eigentümer bleiben auf den Kosten der Mängelbeseitigung sitzen.

Gern vertritt unser Fachanwalt für Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht Ihre Interessen außergerichtlich sowie gerichtlich. Mehr zu unseren Leistungen im Wohnungseigentumsrecht lesen Sie hier.
Weitere Haftungsgefahren für den Verwalter
Bereits die typischen Fehlerquellen, die eine Haftung des Verwalters auslösen können, zeigen, dass neben der klassischen Haftung aus dem Verwaltervertrag, die auf Pflichtverletzungen gegenüber der Wohnungseigentümergemeinschaft beruht, weitere erhebliche Haftungsrisiken für den Verwalter bestehen können. Diese beruhen auf allgemeinen gesetzlichen Regelungen und können im Ernstfall zu erheblichen finanziellen Belastungen führen.
Haftung aus unerlaubter Handlung (§823 BGB)
Eine der wichtigsten zusätzlichen Haftungsquellen ist die deliktische Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB. Danach ist derjenige zum Schadensersatz verpflichtet, der das Leben, den Körper, die Gesundheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich und schuldhaft verletzt.
Für Verwalter bedeutet dies, dass sie, wenn sie im Rahmen ihrer Tätigkeit nicht nur vertragliche Pflichten verletzen, sondern aktiv in Schutzrechte Dritter eingreifen, auch unmittelbar nach Deliktsrecht auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden können.
Beispiel: Die Verletzung von Verkehrssicherungspflichten zeigt: Unterlässt es der Verwalter, offensichtliche Gefahrenquellen am Gemeinschaftseigentum – etwa lose Dachziegel oder vereiste Wege – zu beseitigen, und wird dadurch eine Person verletzt, kann der Verwalter neben einer etwaigen Haftung der Wohnungseigentümergemeinschaft auch persönlich auf Schadensersatz haften.
Dabei reicht einfache Fahrlässigkeit aus. Auch leicht fahrlässiges Verhalten, wie das Übersehen einer offensichtlichen Gefahrenquelle, kann eine Haftung nach § 823 BGB auslösen.
Gerade bei Glatteis, ungesicherten Baustellen oder Bauschäden sind Hausverwaltungen besonders gefordert. Die Organisation des Winterdienstes, regelmäßige Kontrollgänge und die Beauftragung geeigneter Fachfirmen gehören daher zwingend zu seinen Aufgaben.
Haftungsrisiken sowie Kenntnis von Aufgaben und Pflichten
Verwalter und Wohnungseigentümer sollten die Pflichten und Aufgaben kennen, die die GdWE dem Hausverwalter vertraglich übertragen hat. Insbesondere für den Verwalter ist diese Kenntnis sowie die Kenntnis der gesetzlichen und organschaftlichen Aufgaben unerlässlich, um zu erkennen, welche Tätigkeiten er ausführen muss.
Andernfalls drohen dem Verwalter nicht nur Haftungsrisiken, da er gegenüber der Eigentümergemeinschaft für die ordnungsgemäße Verwaltung haftet. Kommt es zu Gefahren und Schäden für Dritte, etwa durch nicht geräumte glatte Wege, weil diese auf einer Pflichtverletzung des Verwalters beruht, kommt ein nicht zu unterschätzendes Haftungsrisiko aus deliktischer Haftung gegenüber Dritten hinzu.
Diese Haftungsrisiken machen deutlich: Ein sorgfältiges Risikomanagement, die Einhaltung vertraglicher und gesetzlicher Pflichten sowie eine umfassende Berufshaftpflichtversicherung sind für Verwalter unerlässlich.
Welcher Maßstab ist bei einer möglichen Haftung anzulegen?
Ob ein Verwalter für eine Pflichtverletzung haftet, hängt maßgeblich davon ab, ob er bei seiner Tätigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Verwalters angewendet hat. Es kommt also nicht darauf an, ob eine Maßnahme im Nachhinein optimal war oder ob ein Schaden eingetreten ist, sondern ob das Verhalten im Zeitpunkt der Entscheidung vertretbar war. War das Verhalten vertretbar, kann eine Haftung ausgeschlossen sein.
Verwalter muss nicht fehlerlos sein
Der rechtliche Maßstab richtet sich dabei nach dem sogenannten „ordentlichen und gewissenhaften Durchschnittsverwalter“. Dieser fiktive Maßstab beschreibt, was ein durchschnittlicher Verwalter unter vergleichbaren Umständen getan hätte. Es kommt also darauf an, ob das Handeln des Verwalters den anerkannten Standards der Immobilienverwaltung entsprach und ob er sorgfältig, vorausschauend und umsichtig gehandelt hat.
Dabei spielt der Einzelfall eine wichtige Rolle: Größe und Struktur der Wohnungseigentümergemeinschaft, die Komplexität der Aufgabe und die Dringlichkeit einer Maßnahme beeinflussen, was als sorgfältiges Handeln anzusehen ist. Der Verwalter einer großen Wohnanlage wird andere organisatorische Standards einhalten müssen als der Verwalter einer kleinen Gemeinschaft.
Der Maßstab orientiert sich nicht an einem perfekten Idealverwalter. Es wird nicht verlangt, dass der Verwalter alle Eventualitäten vorhersehen oder alle Risiken ausschließen kann. Leichte Fehler oder eine vertretbare Entscheidung, die sich im Nachhinein als nachteilig erweist, begründen keine Haftung.
Besondere Anforderungen bei besonderen Kenntnissen
Verfügt ein Verwalter jedoch über überdurchschnittliche Fachkenntnisse, zum Beispiel bautechnische Kenntnisse, Spezialkenntnisse im Mietrecht oder umfassende betriebswirtschaftliche Kenntnisse, so ist ein entsprechend höherer Sorgfaltsmaßstab anzulegen. Wer mehr weiß, von dem wird auch rechtlich erwartet, dass er dieses Wissen verantwortungsvoll einsetzt.
Beispiel: Ein Verwalter, der Bauingenieur ist, wird bei der Auswahl und Überwachung von Handwerkerleistungen höhere Sorgfaltsanforderungen erfüllen müssen als ein Verwalter ohne technische Ausbildung. Erkennt er beispielsweise erkennbare Mängel einer Bauleistung nicht, obwohl sie einem Bauingenieur hätten auffallen müssen, kann dies als Pflichtverletzung gewertet werden.
Ebenso kann ein Verwalter mit juristischem Hintergrund bei der Gestaltung von Verträgen oder bei der Beurteilung von Anfechtungsrisiken in der Eigentümerversammlung strenger prüfen als ein Verwalter ohne juristische Zusatzausbildung.
Benötigen Sie rechtliche Unterstützung?
Unser Fachanwalt für Mietrecht steht Ihnen zur Seite!
Sorgfaltsmaßstab ist keine feste Größe
Insgesamt verlangt das Gesetz vom Verwalter einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern keine übermenschliche Fehlerfreiheit. Entscheidend ist, dass er seine Aufgaben mit der verkehrsüblichen Sorgfalt wahrnimmt, sich über wesentliche Entwicklungen informiert und bei Unsicherheiten externen Sachverstand hinzuzieht.
Wer gewissenhaft dokumentiert, Angebote sorgfältig prüft, Fristen einhält und die Eigentümer regelmäßig informiert, genügt in der Regel dem Maßstab eines ordentlichen Verwalters. Andererseits steigen die Sorgfaltsanforderungen, wenn der Verwalter über besondere Qualifikationen oder Erfahrungen verfügt oder sich in besonders risikobehafteten Verwaltungssituationen befindet.
Wann ist eine Haftung ausgeschlossen?
Verwalter versuchen häufig, ihre Haftung für Pflichtverletzungen durch vertragliche Regelungen einzuschränken. Grundsätzlich ist eine Haftungsbegrenzung im Verwaltervertrag zulässig, allerdings unterliegt sie engen rechtlichen Grenzen.
Eine vollständige Freizeichnung von jeglicher Haftung, insbesondere auch bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, ist unzulässig und wird regelmäßig von den Gerichten als unwirksam angesehen. Zulässig ist in der Regel nur eine Begrenzung der Haftung auf einfache Fahrlässigkeit und auf eine bestimmte Schadenshöhe, vorausgesetzt, die Regelung wurde transparent und individuell vereinbart.
Ermessensspielraum und Beschluss gegen den Rat des Verwalters
Keine Haftung trifft den Verwalter außerdem dann, wenn er aufgrund eines gültigen Eigentümerbeschlusses handelt, selbst wenn dieser Beschluss sich später als fehlerhaft oder unwirksam herausstellt. In diesen Fällen trägt die Eigentümergemeinschaft das Risiko ihrer eigenen Entscheidungen. Ebenso haftet der Verwalter nicht für vertretbare Ermessensentscheidungen oder wenn ein Schaden trotz sorgfältiger Auswahl und Überwachung von Fachleuten eingetreten ist.
Mitverschulden der Eigentümer
Eine weitere wichtige Grenze besteht darin, dass sich der Verwalter auf ein Mitverschulden der Eigentümer berufen kann. Haben etwa Verwaltungsbeirat oder Eigentümer ihre Kontroll- und Mitwirkungspflichten verletzt, kann dies die Haftung des Verwalters mindern oder sogar vollständig ausschließen. Eigentümer sollten daher nicht nur auf eine klare Regelung im Verwaltervertrag achten, sondern auch ihre eigene Mitverantwortung im Verwaltungsprozess ernst nehmen.
Wie können Haftungsansprüche gegen den Verwalter durchgesetzt werden?
Stellt eine Wohnungseigentümergemeinschaft vermeintliche Pflichtverletzungen des Verwalters fest, stellt sich schnell die Frage, ob Schadensersatzansprüche gegen den Verwalter bestehen und wie diese Ansprüche effektiv durchgesetzt werden können. Grundsätzlich ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer selbst anspruchsberechtigt, da ihr die Rechte aus dem Verwaltervertrag zustehen.
Erleiden einzelne Wohnungseigentümer einen Schaden infolge des Verwalterhandelns, können sie ihre Ansprüche nicht gegenüber dem Verwalter geltend, sondern müssen diese Ansprüche gegenüber der Eigentümergemeinschaft geltend machen. Das Verschulden des Verwalters wird dabei der Eigentümergemeinschaft zugerechnet. In der Praxis erfolgt die Durchsetzung häufig über einen entsprechenden Beschluss der Eigentümerversammlung, in dem die Gemeinschaft die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen den Verwalter beschließt.
Prüfung und Beurteilung durch Fachanwalt unerlässlich
Vor einem solchen Beschluss sowie bei Verdacht auf eine Pflichtverletzung und einen möglichen Haftungsfall sollten sich die Wohnungseigentümer jedoch an einen spezialisierten Rechtsanwalt wenden. Die rechtliche Beurteilung, ob tatsächlich eine haftungsrelevante Pflichtverletzung vorliegt, ist zum einen komplex und erfordert zum anderen fundierte Kenntnisse des Wohnungseigentumsrechts sowie eine genaue Analyse des Einzelfalls.
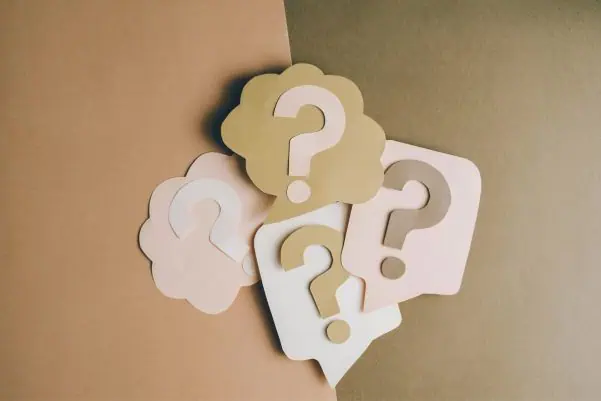
Nur ein erfahrener Fachanwalt kann beurteilen, ob ein Schadensersatzanspruch gegen den Verwalter besteht, welche rechtlichen Schritte erforderlich sind und welches Vorgehen strategisch sinnvoll ist. Auch mögliche Fristen, etwa zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen oder zur Vermeidung der Verjährung, müssen sorgfältig geprüft werden. Darüber hinaus ist im Falle von Pflichtverletzungen zu klären, ob eine fristlose Kündigung des Verwalters erforderlich und zulässig ist.
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht Michael Kehren berät Gemeinschaften der Wohnungseigentümer (GdWE) kompetent und umfassend bei der Prüfung von Pflichtverletzungen und der Durchsetzung von Ansprüchen gegen den Verwalter. Durch seine langjährige Erfahrung im Wohnungseigentumsrecht gewährleistet er eine präzise rechtliche Beurteilung sowie eine konsequente außergerichtliche und gerichtliche Vertretung der Interessen der Gemeinschaft.
Fazit
- Zentrale Rolle des Verwalters und Bedeutung der Haftung: Der Verwalter ist das zentrale Verwaltungsorgan der Wohnungseigentümergemeinschaft und für die Werterhaltung, Verwaltung und Vertretung der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer verantwortlich. Fehler oder Pflichtverletzungen des Verwalters können zu erheblichen finanziellen Schäden führen. Die Haftung des Verwalters schützt daher unmittelbar das Vermögen der Wohnungseigentümer.
- Haftung des Verwalters: Der Verwalter haftet für Pflichtverletzungen, wenn er eine ihm gesetzlich oder vertraglich übertragene Aufgabe fehlerhaft ausführt oder unterlässt, dadurch einen Schaden verursacht und schuldhaft (mindestens fahrlässig) handelt. Typische Haftungsfälle sind fehlerhafte Abrechnungen, unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, eigenmächtige Entscheidungen oder Verletzungen der Verkehrssicherungspflicht.
- Weitere Haftungsrisiken über die vertraglichen Pflichten hinaus: Neben der vertraglichen Haftung kann der Verwalter auch aus unerlaubter Handlung (§ 823 BGB) oder wegen Fristversäumnis (§ 286 BGB) haften. Dabei genügt bereits leichte Fahrlässigkeit, insbesondere bei der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten oder der Versäumung wichtiger Verjährungsfristen.
- Haftungsmaßstab: Ob eine Haftung eingreift, beurteilt sich nach dem Verhalten eines ordentlichen und gewissenhaften Durchschnittsverwalters. Der Verwalter muss nicht fehlerfrei, sondern sorgfältig und vorausschauend handeln. Bei besonderen Fachkenntnissen (z.B. als Bauingenieur) ist ein strengerer Sorgfaltsmaßstab anzulegen.
- Wann eine Haftung in der Regel ausgeschlossen ist: Eine Haftungsfreistellung des Verwalters ist nur eingeschränkt möglich, z.B. bei einfacher Fahrlässigkeit und transparenter Vertragsgestaltung. Keine Haftung besteht bei vertretbaren Ermessensentscheidungen, bei Handeln aufgrund gültiger Beschlüsse oder bei Mitverschulden der Wohnungseigentümergemeinschaft.
- Durchsetzung von Ansprüchen gegen den Verwalter: Wohnungseigentümer sollten bei Verdacht auf Pflichtverletzungen keinesfalls auf eigene Faust handeln, sondern sich frühzeitig an einen auf das Wohnungseigentumsrecht spezialisierten Rechtsanwalt wenden. Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht Michael Kehren prüft mögliche Pflichtverletzungen, berät umfassend zur Haftung und setzt berechtigte Ansprüche konsequent durch.
FAQ
Wann haftet der Verwalter gegenüber der Wohnungseigentümergemeinschaft?
Der Verwalter haftet, wenn er eine gesetzliche oder vertragliche Pflicht verletzt, dadurch ein Schaden entsteht und ihn zumindest Fahrlässigkeit trifft. Typische Fälle sind fehlerhafte Abrechnungen, unterlassene Instandhaltungsarbeiten oder eigenmächtige Vertragsabschlüsse.
Welche Fehler des Verwalters führen häufig zu einer Haftung?
Häufige Haftungsfälle sind verspätete oder fehlerhafte Jahresabrechnungen, nicht erkannte Baumängel, versäumte Gewährleistungsfristen, eigenmächtige Entscheidungen ohne Eigentümerbeschluss sowie die Verletzung von Verkehrssicherungspflichten.
Haftet der Verwalter für jeden Fehler?
Der Verwalter muss nicht fehlerfrei arbeiten. Er haftet nur, wenn sein Verhalten nicht dem Maßstab eines ordentlichen und gewissenhaften Durchschnittsverwalters entspricht. Vertretbare Ermessensentscheidungen oder Folgen von Beschlüssen der Eigentümergemeinschaft entbinden ihn grundsätzlich von der Haftung.
Können die Wohnungseigentümer selbst Ansprüche gegen den Verwalter geltend machen?
In der Regel nicht. Anspruchsberechtigt ist die Wohnungseigentümergemeinschaft, die auch den Vertrag mit dem Verwalter geschlossen hat. Nur in Ausnahmefällen, z.B. bei direkten Schäden am Sondereigentum, können einzelne Eigentümer selbst Ansprüche geltend machen.
Was sollten Wohnungseigentümer tun, wenn Sie eine Pflichtverletzung des Verwalters vermuten?
Wohnungseigentümer sollten auf keinen Fall auf eigene Faust handeln, sondern sich frühzeitig an einen auf das Wohnungseigentumsrecht spezialisierten Rechtsanwalt wenden. Fachanwalt Michael Kehren berät umfassend, prüft die Haftung und setzt berechtigte Ansprüche professionell durch.
Bildquellennachweis: pixelshot | Canva








